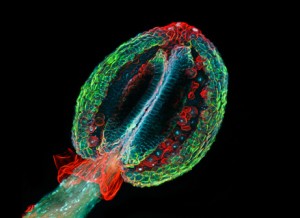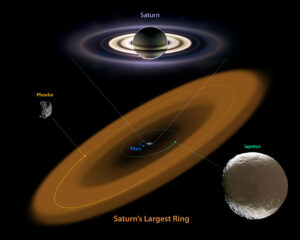Der seit Langem als erster typischer Vogel betrachtete Archaeopteryx hatte vielleicht doch mehr mit seinen Dinosauriervorfahren gemeinsam als bislang angenommen. Zu diesem Schluss kommen Gregory Erickson von der Florida State University in Tallahassee und seine Kollegen, nachdem sie ein Fossil des Tieres genauer untersuchten und mit anderen vogelähnlichen Dinosauriern verglichen. Die Forscher durften dazu winzige Proben aus einem versteinerten Exemplar des sog. Urvogels aus der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie in München entnehmen.
Der Knochenbau überraschte die Paläontologen: Vögel besitzen normalerweise sehr leichte, schnell wachsende und mit zahlreichen Blutgefäßen durchzogene Knochen. Nicht so Archaeopteryx, dessen Skelett eher dem von Eidechsen glich, sehr dicht war und kaum durchblutet wurde. Im Gegensatz zu modernen Vögeln, die rasch erwachsen werden und deren Knochen innerhalb weniger Wochen ausreifen, benötigte ein junger Archaeopteryx über zweieinhalb Jahre, bis sein Skelett ausgereift war.
Diese Ergebnisse verglichen die Wissenschaftler mit anderen vogelähnlichen Dinosauriern, die enge Verwandte des Archaeopteryx sind, sowie mit zwei weiteren frühen Vögeln, die man in China gefunden hatte: dem kurzschwänzigen Sapeornis chaochengensi und dem langschwänzigen Jeholornis prima, die beide schon voll befiedert waren und fliegen konnten. Sie alle wiesen den gleichen Knochenbau auf wie ihr berühmter Verwandter aus dem fränkischen Solnhofen. Demnach waren diese Tiere alle noch eher Dinosaurier als Vogel, deren heutiger Körperbau und Stoffwechsel sich also erst einige Millionen Jahre später entwickelte.
Was Dinosaurian Physiology Inherited by Birds? Reconciling Slow Growth in Archaeopteryx
Reconstructing growth patterns in extinct reptiles
wissenschaft.de – Außen Vogel, innen Dino
Solnhofen und seine Fossilien