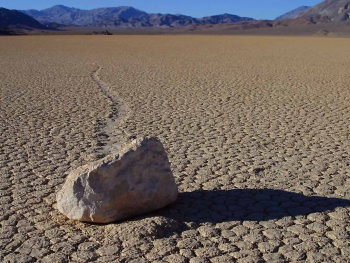Digitales Geländemodell der Grabenstruktur
südlich von El Hierro mit dem neu entstandenen Vulkan.
Der Krater ist deutlich zu erkennen.
(Instituto Español de Oceanografía (IEO))
Zum Vergrößern das Bild anklicken.
In der Nacht zu Montag, den 10. Oktober 2011 ist durch einen Magma-Ausbruch fünf Kilometer südlich der Kanaren-Insel El Hierro ein Unterwasser-Vulkan entstanden.
Wissenschaftler vom spanischen Institut für Ozeanografie unter Leitung von Juan Acosta und Francisco Sánchez konnten den 300 Meter unter der Wasseroberfläche befindlichen Vulkan von Bord des Forschungsschiffes
„Ramón Margalef“ aus mit Hilfe von Echoloten und unter Einsatz des Tauchroboters „Liropus“ vermessen.
Der neu entstandene Vulkan ist demnach etwa 100 Meter hoch und hat an seiner Basis einen Durchmesser von 700 Metern, der Krater ist etwa 120 Meter breit.
An der Meeresoberfläche hat das austretende Gas der Magma-Eruption aufgrund chemischer Veränderungen des Wassers einen riesigen, grünlich gefärbten Fleck geschaffen, der inzwischen größer als die gesamte Fläche der Kanaren-Insel El Hierro ist. Da mittlerweile mehr Schlacke- und Asche-Partikel an die Oberfläche gelangen, ändert sich der Fleck nun zunehmend ins Bräunliche.
Weitere Infos und aktuelle Satellitenaufnahmen:
Mente et Malleo: Unterwassereruption auf El Hierro
Vulkanausbrüche bei El Hierro: Vor den Kanaren könnte neue Insel entstehen
El Hierro Submarine Volcanic Eruption October 2011